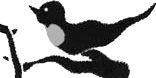
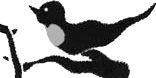
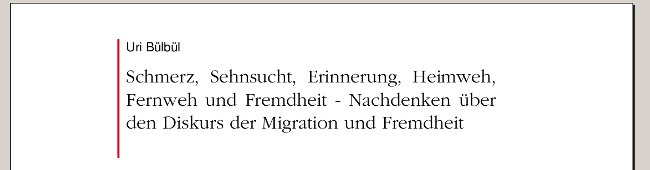
Fremdheit ängstigt und Befremden verunsichert. Wer seine gewohnte Umgebung verlässt und in eine fremde Kultur, in eine fremde Gesellschaft mit einer unverständlichen Sprache kommt, macht eine elementare Erfahrung der Unsicherheit. Und wenn es so etwas gibt, wie Körpergedächtnis, das elementare Erfahrungen unauslöschlich abspeichert wie zum Beispiel das einmal gelernte Fahrradfahren, dann gehört die Erfahrung, in der Fremde gelandet zu sein, zu solchen, die sich ins Körpergedächtnis einbrennen.
Und wer glaubt, dass dieses Körpergedächtnis eine individuelle Angelegenheit sei, könnte
sich täuschen. Eine rationalistische Psychologie, die positivistisch orientiert ist,
vernachlässigt, wieviele körperliche Informationen von Eltern auf ihre Kinder auf
nicht genetischem Wege übertragen werden. Insofern könnte Körpergedächtnis
einerseits etwas höchst Individuelles sein, andererseits aber auch etwas Überindividuelles
und von einer Generation auf die nächste Übertragbares.
Um welche psychischen Tiefenphänomene es sich bei Migrationserfahrungen handelt, vergessen wir recht schnell, wenn wir von Anpassung, Integration und ähnlichen Dingen vernünftelnd sprechen. Vieles aber im Körpergedächtnis entzieht sich der Oberfläche der Vernunft und sitzt tief in einem drin.
Und vielleicht ist es nicht einmal das Gefühl, das Heimatdorf zum ersten Mal für eine längere Zeit zu verlassen, das eine so große Rolle spielt. Nicht alle Emigranten brachen ungern auf.
Aber schon die Ankunft in einer Metropole wie Istanbul löste bei manch einem aus
Anatolien oder der fernen Osttürkei Befremden und Erstaunen aus.
Vielleicht ist es hier schon die Geräuschkulisse oder sind es die Gerüche und die auf
einen niederprasselnden visuellen Eindrücke, die unauslöschliche Spuren hinterlassen.
Und irgendwann wird es einem mehr oder minder klar, dass man in einen reißenden Strom
gesprungen ist und es kein Zurück mehr gibt.
Ein reißender Strom, der einen der vertrauten Welt entreißt, in eine neue schleudert
und entwurzelt irgendwo zurücklässt.
Möglich ist aber auch, dass die Entwurzelung längst an einer anderen Stelle
der persönlichen Geschichte stattgefunden hat, noch bevor man aufbrach, um Neues zu
erkunden. Dieser Moment hat bestimmt auch etwas mit Blöße zu tun, mit dem Gefühl, nackt und hilflos zu sein – mit dem Wenigen am Leib und im Koffer, was einem kaum eine Schutzhülle bietet, aber doch so wichtig ist, dass man es lieber ganz gut festhält, als habe die ganze außer Rand und Band geratene Welt nichts anderes im Sinn, als einem die wenigen Habseligkeiten zu entreißen. Damit und mit ein paar Erinnerungen ausgestattet, fühlt man sich gewappnet, um gegen das Neue zu trotzen, das einen einfach verschlingen will.
Allerdings und vielleicht muss man sogar sagen: Gott sei Dank, bleiben das nicht die einzigen tiefgreifenden Erfahrungen, die man in der Emigration macht. Sonst wäre man vom Fremden und vom Gefühl der Fremdheit völlig erschlagen. Prozesse der Gewöhnung, der Routine, der Alltäglichkeit und des Einlebens setzen ein und hinterlassen ebenso ihre Spuren und Furchen. Nicht dass man einen Prozess der perfekten Germanisierung durchläuft und binnen weniger Jahre oder gar Monate von einem Ali zu einem Alfred wird, aber man bleibt nicht dem Fremden fremd wie am ersten Tag der Ankunft, man wird in der Tat einverleibt und verleibt sich auch das Fremde ein. Man bekommt Plätze zugewiesen: zum Schlafen, zum Essen, zum Wohnen, zum Arbeiten und lässt von diesen Plätzen aus den Blick schweifen, richtet sich ein oder sucht sich etwas Neues. Überhaupt wird, wenn von Migration die Rede ist, dem Einleben viel zu wenig Beachtung geschenkt. Man spricht von Anpassung oder Integration, sollen sich die Fremden assimilieren oder sollen sie ihre eigene fremde Identität wahren? All dies sind Kopffragen, die wenig bis gar nichts mit der gelebten und gefühlten Realität der Individuen zu tun haben. Es sind die Fragen einer rationalistischen Politik, die den Demographieschock zu überwinden versucht und im Grunde selbst in einer Kultur- und Wertekrise steckt.
Leistung, Konsum und Wohlstand sollten es sein, die die Eckpfeiler dieser Gesellschaft darstellen, immer aber sägten und sägen elementare Gefahren an ihnen: sei es die Gefahr eines atomaren Krieges zu Zeiten der Konfrontation der Ost-West-Blöcke, sei es das Waldsterben oder die Ölkrise, sei es das Ozonloch oder der Klimawandel, der Terrorismus oder seien es die Wirtschaftskrisen mit Börsencrashs – immer drohen Gefahren, die die Konstituenten der Gesellschaftspolitik durchrütteln. Wie man politisch kurzfristig und spontan auch auf die Dinge reagierte und sich und der Welt ein konzeptionelles Vorgehen vorzugaukeln versuchte, blieb doch die Tatsache der Unsicherheit, die man gerne durch Leitkulturkraftmeiereien wegzugaukeln versuchte.
Was ist von einer Gesellschaft und ihrer Politik zu halten, wenn
geballte Inkompetenz auf unterschiedlichsten Ebenen die demographische
Entwicklung beeinflusst wie ein Gärtner das
Wachstum seiner Pflanzen? Wenn eine Frau im besten gebärfähigen Alter
schwanger wird, wird das in Deutscher Denkweise
angesehen wie eine riesengroße Schlamperei in der Verhütungspraxis;
ein Verrat an der Emanzipation der Frau, die immer
und ganz einzig als Karriere im Berufsleben angesehen wird.
Eine emanzipierte Hausfrau und Mutter ist in dieser Denkweise
eine Contradictio in adjecto. Und ein Hausmann wird den Ruf
nicht wirklich los, sich von seiner berufstätigen Frau aushalten
zu lassen, kein „richtiger“ Mann ist, der es geschafft hat, seine
Familie zu ernähren. Wen wundert‘s, wenn die Deutschen dann
„aussterben“?
Die Sozialpolitik der DDR wurde nach dem Mauerfall und zuvor erst recht
aufgrund des Kalten Krieges tabuisiert und als
unbezahlbar und marktwirtschaftlich ruinös dargestellt. Schaut
man sich aber mal die Geburtenstatistiken der 70er Jahre in
der ummauerten Republik an, kann man feststellen, dass es
sehr viele junge Mütter trotz kostenloser Pille und freier Abtreibungsmöglichkeit
gab, was man auch dadurch erklären kann,
dass die Menschen ungehindert und unkontrolliert frei kaum
etwas hatten als eben Sex – zumindest heterosexuellen Sex.
Der paternalistisch totalitäre Staat schenkte den Bürgern eine
Form von sozialer Unbeschwertheit, was sich auch an Geburtenraten niederschlug.
Um Mißverständnisse zu vermeiden:
Nicht alles ist blind zur Nachahmung empfohlen, was man sich
erst einmal als Phänomen betrachten könnte, anstatt es zu tabuisieren.
Eben diese Betrachtung aber könnte schon hilfreich
zu neuen Erkenntnissen in Sozial- und Kulturpolitik führen und
neue Ideen entwickeln helfen, die weder die DDR ummauerte Wohlfahrtsstaatlichkeit
noch den westlich kapitalstischen
Marktfetischismus als vorbildhafte Realität nachahmten.
Viele sozial- und kulturphilosophischen Paradigmen und stillschweigenden
Voraussetzungen gesellschaftspolitischer Praxis
stehen auf dem Kopf und müssten systematisch diskutiert und
die Ergebnisse dieser Diskussion praktisch verwirklicht werden.
Aber davon scheinen wir weit entfernt. Ob es das Paradigma ist,
dass Angst vor Bestrafung vor Kriminalität bewahrt,
oder ob es das Paradigma ist, dass Kinder und Familie nicht zu
einem erfolgreichen Leben gehören, sondern dass Erfolg nur
als Berufs- und Karriereerfolg gilt, oder ob es das Paradigma
ist, dass Menschen grundsätzlich ihrem Wesen nach arbeitsscheu
und faul sind und erst durch mehr oder weniger sanften
Handlungsdruck zur Produktivität und Arbeit neigen, oder ob
es das Paradigma ist, dass Hedonismus und Leistungsbereitschaft
einander ausschließen. Es gibt viele Paradigmen, die
eine pragmatisch-humanistische Politik durch eine autoritäre,
gewaltpräferierende, repressive ersetzen. Eine der schlimmsten
Auswüchse sind die Hartz IV-Behörden, ob man sie früher
„Arbeitsämter“ nannte und nun zu „Arbeitsagenturen“, „Jobcentern“
euphemisiert d.h. schönlügt, kaum an einer anderen Stelle
ist die Diktatur der Verwaltung (also Bürokratie) grausamer und
menschenfeindlicher zu spüren wie hier. Einerseits wird den
arbeitsuchenden Menschen Faulheit und mangelnde Eigeninitiative unterstellt,
so dass sie permanent in Beweisnot ihrer Bedürftigkeit sind,
andererseits werden sie zu „Kunden“ stilisiert.
Diese Verlogenheit hinterlässt tiefe Spuren in der Gesellschaft
– und zwar nicht nur bei denen, die direkt von dieser Behörde
betroffen sind, sondern auch unter Kindern einer Klasse in der
Schule, im Alltagsdiskurs der Jugendlichen, die noch zur Schule
gehen oder eine Ausbildungsstelle suchen oder bei Erwachsenen, die
um ihren Erwerbsarbeitsplatz bangen, weil außer
den Verursachern der Krisen niemand vor den Auswirkungen
wirtschaftlicher Tiefs sicher ist. Die Sozialbehörde hat mit ihrer
Unterstellungs- und Verleumdungsanthropologie, dass wer
keine Arbeit findet, selbst schuld und faul sei, und man diesem
„Mißbrauch“ administrativ einen Riegel vorschieben müsse,
eine Schreckensherrschaft errichtet, die mittlerweile den Namen
„Hartz-IV-Terrorismus“ verdienen dürfte. Noch nie war diese
knapp siebzigjährige Republik so weit von ihren eigenen Verfassungsidealen
der Einigkeit, Recht und Freiheit entfernt
wie in den letzten Jahren.
Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die USA
als paradigmatische Demokratie auf die Anschläge vom 11. September so inhuman
und undemokratisch wie nur möglich
reagierten. Die westliche Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zeigte
in Guantanamo und dann auch in der Tötung Ossama Bin Ladens ihr anderes Gesicht,
die andere Seite des Januskopfes.
Und die zwielichtige Rolle des Verfassungsschutzes in Sachen
Kooperation mit der rechtsradikalen und rechtsterroristischen
Szene, zeigt auch nicht gerade ein vertrauenschaffendes Antlitz
der westlichen Gesellschaft. Man möchte sich heute überhaupt
nicht ausmalen, welches Krisenmanagement die gegenwärtige
Politik an den Tag legen würde, wenn es zu einer atomaren,
klimabedingten oder kriegerischen Katastrophe in Deutschland
käme. Da ist es deutlich leichter, soziale und kulturelle Probleme
auf die Tagesordnung zu setzen, die man auf dem Themenfeld der Migration
zu finden glaubt oder die Nichtraucherverordnung der EU durchzusetzen.
Ausländer dienen hierbei
nicht -oder muss man sagen: noch nicht?- als Sündenböcke,
aber sie bieten eine willkommene Ablenkung von den Problemen einer zu einer
Bananenrepublik verkommenden Demokratie. Zugleich aber sollen die Menschen
direkt am eigenen
Leib spüren, wozu Politik lenkend in der Lage ist, indem sie
die Nichtraucherverordnung rigide realisiert, während zugleich
durch unkontrollierten Einsatz von gentechnisch manipulierten
Lebensmitteln, oder unkontrollierten Einsatz von Antibiotika
in der Massentierhaltung oder durch multiresistente Keime in
deutschen Krankenhäusern und durch viele andere Faktoren
wie zum Beispiel ein aus dem Ruder laufendes atomares Lager
wie Asse oder durch verschiedene Lebensmittelskandale die
Gesundheit der Bürger erheblich beeinträchtigt wird.
Ebenso ist es interessant zu sehen, wie die Diskussion um Elektrosmog
aus der öffentlichen Debatte verschwindet, während
Hersteller von elektronischen Kommunikations- und Navigationsgeräten
Absatzrekorde feiern. Im Übrigen ist die Herstellung
dieser Geräte mit einer großen Ausbeutung von Rohstoffquellen
afrikanischer und asiatischer Länder verbunden, wobei die
Verelendung ganzer Staaten, Gesellschaften und Volksgruppen
billigend in Kauf genommen wird.
Die Zunahme der Sichtbarkeit von Kopftuchträgerinnen rührt
nicht so sehr vom demographischen Wandel her als von der
mangelnden Ausstrahlungskraft westlicher Kulturideale. Technischer
Fortschritt imponiert und überzeugt nicht mehr so sehr
wie er die erste Generation von „Gastarbeitern“ für sich einnahm.
Das Besondere, ein Auto zu besitzen oder einen Farbfernseher und
eine Waschmaschine ist mittlerweile eine nicht
erwähnenswerte Normalität geworden. Und die hier aufgewachsenen
„Ausländergenerationen“ lassen sich mit derlei billigem Firlefanz nicht
mehr in elementareren kulturellen Wertefragen „überzeugen“.
Man will zwar technische und andere
Konsumgüter besitzen und dennoch eine eigene Lebensweise
finden und eine eigene Religion praktizieren.
Wie schmerzhaft ist es für die ältere Generation von „ausländischen Arbeitnehmern“,
die viel von ihrem Leben, von ihrer
Arbeitskraft und häufig auch von ihrer Gesundheit in dieses
Land und in diese Gesellschaft investiert haben, zu sehen, wie
ihre Kinder und Kindeskinder mißtrauisch beäugt, mit Vorurteilen
verfolgt und mit antidemokratischer Propaganda zu Randfiguren gestempelt
werden. Dabei sind das jene Menschen, die
in der sogenannten „Leitkultur“ nicht sich und ihre Identität
wiedergefunden haben und nach neuen und vor allem nach
eigenen Wegen suchen. Dabei kommt es immer häufiger vor,
dass sie sich auch an die Herkunftskulturen ihrer Eltern und
Großeltern erinnern und in der Renaissance teilweise fiktiver
oder unverstandener Geschichten eine Identität und kulturelle
Heimat für sich suchen.
Noch einmal kann man sich aus deutscher Sicht aufbäumen, groß und stark fühlen, wenn man auf Leute zeigen kann, die sich zwar bestens eingelebt, aber nicht die alltagskulturellen Praktiken der Einheimischen übernommen haben, die da in etwa wären: Taubenzüchterverein, Schützenverein, Kirchenchor, freiwillige Feuerwehr oder Kleingartenverein oder Kneipenstammtisch. Nicht dass dort überhaupt keine Zugewanderten vereinzelt auftauchten; wichtig ist, dass die Eingewanderten nicht in solchen konventionellen Einrichtungen zum Verschwinden gebracht werden, sondern ihre eigenen Vereine, Treffpunkte, sozialen Kommunikationsstrukturen realisieren. Das aber bedeutet, dass sie sich eingelebt haben; denn dieser Ausdruck beinhaltet die Subjektivität der Menschen in der Fremde. Ihr eigenes Leben, ihre eigene Geschichte, ihre Gewohnheiten, Sitten und Gebräuche bleiben und finden neue Orte, wo sie gelebt werden können. Der Ausländer steht nicht mehr mit weit aufgerissenen Augen und aufgerissenem Mund, gebückter Haltung und sich an seinen Koffer klammernd am Bahnsteig, sondern hat sich eingelebt. Fremdheit und Befremden sind überwunden, ohne dass eine Assimilation stattgefunden hätte. Das heißt mit anderen Worten: die Neuankömmlinge sind nicht unsichtbar geworden, haben sich nicht wie Zucker im warmen Tee aufgelöst,
sondern haben ihre Plätze in der Gesellschaft eingenommen
- und ja, sie haben
Subkulturen gebildet – und keine Parallelgesellschaften, wie
eine fremdenfeindliche Politik uns glauben machen will. Denn
Parallelen schneiden sich bekanntlich im Unendlichen, also
gibt es keine hiesigen Schnittstellen und Berührungspunkte;
Subkulturen hingegen haben eine Permeabilität, man kann sie
verlassen, man kann sie aufsuchen und man kann als Individu-
um auch mehreren Subkulturen gleichzeitig angehören.
Vielleicht sind das nicht die wünschenswertesten und zufriedenstellendsten
Plätze, vielleicht sind das sogar Plätze, die man
gerne wieder verlassen und neue einnehmen würde. Wie auch
immer ist aber ein Verschwinden nicht mehr möglich. „Der
Islam gehört zu Deutschland“ kann man nun aus einheimischer Sicht sagen;
deutlich zu hören ist dabei das ängstliche
Beben der Stimme wie beim lauten Pfeifen im Walde.
Letztendlich könnte die Toleranz gegenüber dem Fremden noch einmal dazu
herangezogen werden, sich der eigenen Identität, die sonst im Wandel der Geschichte
verlorenzugehen droht, zu vergewissern. Noch einmal kann man aus
der Zauberkiste die Kulturnation hervorholen und die wunderbare Handpuppe erzählen
lassen, wie der Deutsche dem Rest der Welt intellektuell, kulturell, wirtschaftlich
wie wissenschaftlich, technologisch und sportlich überlegen ist.
Die nationale Gigantomanie braucht ihre Mythen. Wer aber braucht die nationale
Gigantomanie in einer globalisierten Welt? Sind wir nicht alle Bürger des Kosmos
und Menschen mit denselben unveräußerlichen Grundrechten?
Oder Geschöpfe Gottes, wer das besser versteht?
Hatte Christian Wulff als Bundespräsident noch den Islam als
zu Deutschland gehörig propagiert, kassierte sein Nachfolger
als höchster Repräsentant des deutschen Staates diese These
relativierend wieder ein und korrigierte: nicht der Islam, sondern die
Muslime, die hier lebten, gehörten zu Deutschland.
Damit wurde offiziell eine alte aufklärerische Erkenntnis, dass
die drei Weltreligionen miteinander verwandt auch zu Europa
und europäischen Geschichte gehören, was einem Gotthold
Ephraim Lessing noch bekannt war und in der berühmten Ringparabel
ihren Niederschlag fand, gegen die dümmliche These
ausgetauscht, dass auf der einen Seite das christlich-jüdische
Abendland stehe und auf der anderen der islamische Orient.
Und die jüdische Tradition hatte man wahrscheinlich nur mitgenommen,
um nicht die Holocaustopfer zu brüskieren. Wer
solch dummes Zeug vertritt sollte eigentlich mit römischen Zahlen rechnen,
die durch den Orient überlieferte abendländische
Philosophie meiden, Algebra aus dem Wissensschatz und dem
Schulunterricht streichen und sich auch der alltagskulturellen
Einflüsse des Orients wie des Kaffees enthalten. Das Signal des
neuen fahnenknutschenden Bundespräsidenten kam an: die
Menschen dürfen bleiben, sie müssen nur die Überlegenheit
der westlichen Kultur anerkennen und sich einem unbeugsam oder unverbesserlich
gebendem Protestantismus beugen.
Aber bitte welche Überlegenheit? Es war nicht das Christentum
– nicht in seiner protestantischen, nicht in seiner katholischen
Ausprägung, was den wissenschaftlich-technischen Fortschritt
Europas beförderte, es war die Renaissance als Gegenbewegung zur
kirchlich-doktrinären Pseudowissenschaft. Ist der Inquisitionsprozess
gegen Galileo Galilei von Brecht dramatisiert
nicht mehr Schulstoff in dieser Republik? Oder liegt das für den
einen oder anderen schon zu weit zurück? Oder zu weit westlich des eigenen Bildungsweges?
Oder gibt es welche, die dann doch ein wenig menschlicher sind als die anderen, wie es schon immer welche gab, die gleicher waren als die anderen? Nicht der Islam gehört zu Deutschland, sondern die Religionsfreiheit, die Freiheit des Gewissens und des Glaubens in eine demokratisch verfasste Gesellschaft. Wir sind uns fremd geworden, wir Menschen in einer sich stetig verändernden Welt sind wir uns selbst fremd und müssen uns immer wieder neu einleben. So gesehen befinden wir uns alle in einem reißenden Strom, nur dass die einen sich dessen vielleicht nicht so bewusst sind wie diejenigen, die schon einen „Migrationshintergrund“ haben. „Heimat ist der Ort, wo man sich wohlfühlt“, sagte mal ein ökologisch engagierter Freund und fügte hinzu „Insofern sind wir alle Heimatvertriebene!“ Man kann diese Heimatvertriebenheit durch Deutschtümelei oder das Geschwätz von kultureller Überlegenheit noch ein wenig verdrängen und über Leitkultur diskutieren.
Thilo Sarazzin hat insofern vielen Menschen tatsächlich aus der Seele
gesprochen, weil er in einer offensichtlich RTL/SAT/ProSieben-
debilisierten Gesellschaft Intelligenz noch einmal zum Erbgut
machen wollte, zu etwas, was einem angeboren sein kann, ganz
gleich, wie überaltert und überkommen das Bildungssystem ist
und ganz gleich, wieviel Stunden in der Woche angeleitet von
einem schlagersingenden Popgroßmaul Deutschland den Superstar sucht.
Ob Oliver Geisen-Show oder Bauer eine Frau
sucht, ob Messi-Alarm oder Sendungen über Fettabsaugen, wo
unleugbar Dummheit so sehr die Medien überflutet und man
gar nicht mehr weiß, wie man Sendezeit totschlagen soll, da ist
es Balsam für die angeknackste Seele, wenn jemand sagt: «Da
werden Sie geholfen! Wir können auch intelligent, weil das ist
angeboren!» Wer angesichts so viel Dummheit den Anspruch
auf Leitkultur erhebt, läuft in der Tat Gefahr, sich hoffnungslos
lächerlich zu machen, es sei denn die Ausländer geben selbst
als «Gangstarapper» den zu missionierenden Blödmann ab.
Die Kulturnation hat ihre kritische Masse erreicht und droht zu zerfallen, wenn nicht bald eine intelligente Atmosphäre des Miteinander gefunden wird, die nicht Ausgrenzung und Konkurrenz favorisiert, sondern Inklusion und Solidarität. Auf Furcht und Neid wird sich dieses Miteinander nicht gründen lassen; wie wäre es mit Einigkeit, Recht und Freiheit oder mit Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit? Wissen wir überhaupt noch, wie diese Elemente unserer gesellschaftlichen Verfasstheit zu leben sind?
Mit Korruptionsaffären, gewährten Freundschaftskrediten, Bordellbesuchen auf Steuerkosten, Diätenerhöhungen, Managerboni oder überbezahlten exquisiten Vorträgen auf der einen und Hartz-IV-Repression auf der anderen Seite bestimmt nicht.
Wem ist das Fremde eigentlich wirklich noch fremd? Wenn das Fernsehen kopftuchtragende Frauen vor orientalisch anmutenden Gemüseläden zeigt und jemand aus dem Off von mangelnden Deutschkenntnissen und Integrationsproblemen spricht, versucht man das Fremde als Mythos am Leben zu erhalten; denn im Grunde ist eines klar: Heutzutage gibt es kaum eine kopftuchtragende Frau, die nicht perfekt Deutsch spricht und selbst der gebrochen Deutsch sprechende Obsthändler ist weder fremd noch fühlt er sich fremd. Er ist in seiner Straße, in seinem Viertel zuhause und versteht sich mit jedem, der mit ihm kommuniziert. Wenn man seinen Laden und seine Frau oder Tochter aber als Bilder der mangelnden Integrationswilligkeit mißbrauchen möchte, wird er wieder zum Fremden. Wie soll denn bitte schön eine typisch deutsche Straße aussehen? Ganz klar: ohne ASIA-Shop, Gemüsehändler, Dönerbude, ohne eine Pizzeria oder ohne Eiscafé, dafür aber mit Douglas, H&M, McDonalds und Mediamarkt.
Es wird wirklich höchste Zeit, die Bilder zu hinterfragen, die unsere heutigen Kulturdiskussionen prägen. Soll man das originär Deutsche und von allen Ausländern befreite und bereinigte etwa so vorstellen wie die Innenstadt von Rothenburg ob der Tauber? Bamberg oder Heidelberg? Tübingen oder München? Die Türken haben irgendwann Konstantinopel in Istanbul verwandelt und beinahe hätten sie auch die Residenzstadt der Donaumonarchie auf dem Gewissen gehabt und nun machen sie sich breit in Berlin oder Hamburg, in Gelsenkirchen oder Duisburg. In Stuttgart, der schwäbischen Metropole sind ganze Stadtteile nach ihnen benannt da gibt es Ober- und Untertürkheim. Wie soll man dieser „Überfremdung“ paroli bieten? Der demographische Wandel nimmt seinen unsäglichen Lauf. Die Deutschen sterben aus, und die Fremden greifen um sich. Und der Türke steht für das bedrohliche Fremde überhaupt, wie einst der Iwan für die kommunistische Bedrohung stand, für den Bolschewismus, für die Entrechtung und Knechtung eines jeden freien Individuums.
Es gibt eine Reihe von soziologischen und sozialpsychologischen Untersuchungen zur Erforschung solcher Wahn- und Mythengebilde, eine der bekannteren sind Theodor W. Adornos «Studien über den autoritären Charakter», die in den USA durchgeführt wurden. Ob Antisemitismus oder Islamophobie, ob Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit, Motive und Inhalte sind nicht in der Sache selbst zu suchen. Diese Einstellungen haben nichts mit der Wirklichkeit der Kriminalstatistiken zu tun oder mit den „Charaktereigenschaften“ von Afroamerikanern, Afrikanern, Türken oder anderen Orientalen. Die Argumente werden immer im Nachhinein zur Begründung und Rationalisierung von Einstellungen herangezogen, die eine ganz andere ursächliche Herkunft haben. Sich dies immer wieder zu vergegenwärtigen und nach den wahren Ursachen für jene Einstellungen zu suchen, die Adorno „autoritär“ nennt, ist für ein entspanntes Miteinander im Gemeinwesen unabdingbar. Mit Parolen wie „Nazis raus!“ als Antwort auf „Ausländer raus!“ ist es definitiv nicht getan. Ein moralisches Naserümpfen und Ignorieren ist auch keine große Hilfe. „Die paar braunen Spinner“ oder „ewig Gestrigen“ sind Floskeln der Ignoranz und der Verharmlosung. Sie festigen nicht gerade den Grund, auf dem die Demokratie steht.
Vielmehr müssen Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Faschismus (das ist die Anhängerschaft von gewaltsamen Lösungen bei gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Problemen) ernst genommen werden. Und die wirksamen Mittel dagegen sind nicht Gesinnungs- und Parteiverbote, sondern im ersten Schritt die offene Diskussion über die möglichen Ursachen solcher Einstellungen. Eine solche Diskussion wird nicht verhehlen können, dass viele harmlos anmutende Einstellungen in Kombination und Summe zu den radikalen Spitzen führen. Und viele in der Gesellschaft haben kleine und große Bausteine für die radikale Einstellung geliefert und bereitgestellt und tun im Nachhinein scheinheilig empört über die braunen Auswüchse, die dabei einen guten und fruchtbaren Nährboden erhalten haben.
Antisemitismus
und Fremdenfeindlichkeit sind nicht aus den Randbereichen
dieser Gesellschaft entstanden, sondern aus ihrer Normalität.
Diese Normalität reicht bis zum Beginn der Industrialisierung,
die ja in Deutschland bekanntlich später einsetzte als in England und Frankreich.
Mit der Reichsgründung allerdings eine
enorme Beschleunigung erfuhr. „Einigkeit und Recht und Freiheit“ waren zunächst
auch nicht auf die Menschen in diesem
Staat gemünzt, die sich als Individuen akzeptiert, respektiert
und gefördert sehen durften, sondern auf das „deutsche Vaterland“.
Der Mensch dem „Vaterland“ subsummiert konnte als
Unternehmer, Staatsbürger, Standesangehöriger, Untertan oder
als „soziale Frage“ auftauchen, galt aber auch immer als mißtrauisch zu
beäugender und bespitzelnder Unruheherd. Versammlungsrecht, Vereinsrecht
oder Recht auf freie Meinungsäußerung, Bildung von Organisationen wie Gewerkschaften
waren keinesfalls Selbstverständlichkeiten, sondern wurden
immer als ein Gefahrenpotential für Ruhe und Ordnung angesehen. Und die Kirchen
mischten als Normierungs- und
Anstandsinstanz kräftig mit. Ob das das Kaiserreich oder die
Weimarer Republik war. Später nach der Nationalsozialistischen
Ära wurde genau darin wieder die Ursache für die „Machtergreifung“ gesucht und
häufig festgemacht. So geriet die einzig demokratische Phase der
deutschen Geschichte bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges, die Weimarer Republik, immer
wieder ins Zwielicht. Es ist schon ein historischer Paradigmenwechsel, wenn
Rechte und Glück von Individuen zu einem
Teil des Staatsräsons werden. Der aus der Vergangenheit in die
Gegenwart der Bundesrepublik verschleppte Antihumanismus,
nationale Überheblichkeit chauvinistisch-kolonialistische Betrachtungsweise
der Welt außerhalb der eigenen Nation wurden keineswegs ausgemerzt.
Und bevor die Kirchen sich anheischig machen, in sogenannten interreligiösen
Dialogen Imamen „Demokratieschulungen“ anzubieten, sollten sie
in ihren Institutionen glaubhaft ihren eigenen Humanismus auf den Prüfstand
stellen. Menschen anderer Nationalitäten, Ethnien und fremder
Herkunft fielen nicht unter die demokratische Maxime einer
„Einigkeit, Recht und Freiheit“. Für sie galt und gilt das „Ausländerrecht“.
Die „Gastarbeiter“, die angeworben wurden, standen
in der Tradition von „Zwangs-“ bzw. „Fremdarbeitern“, die man
immer wieder entrechtet ins Land holte, da es auch immer Bedarf
an Arbeitskräften gab. Natürlich entschärfte sich vieles an
Inhumanem, der Fremdkörpercharakter von solchen Arbeitskräften
aber blieb durchaus bestehen. Sie wurden nicht Teil des
„deutschen Volkskörpers“ mit einer entsprechenden „deutschen
Volksseele“, auf deren Idee auch die Germanistik als Kulturwissenschaft beruhte.
Die Romantik insbesondere die Gebrüder
Grimm hatten nicht umsonst die Erforschung der „Volksmärchen“,
„Volkslieder“ oder der deutschen Sprachgeschichte angeregt und fleißig betrieben.
Dem ganzen Kulturtreiben immanent blieb die Idee einer einenden
„Volksseele“. Später sprach
man lieber von „Nationalkultur“ analog zu der Wortkosmetik,
das „Arbeitsamt“ in eine „Agentur für Arbeit“ umzubenennen.
Einerseits stehen Euphemismen natürlich für einen gewissen
Wandel in Atmosphäre und Weltsicht. Denn sonst bräuchte man
sie ja nicht einzuführen; auf der anderen Seite aber wollen sie
gerade durch kleine kosmetische Änderungen das Alte aufrecht
erhalten. In der Tradition dieser „Nationalkultur“ steht nun auch
die „Leitkultur“-Idee. So wird von vielen konsequenterweise
auch Anpassung verstanden. Wer dem Volkskörper nicht fremd
bleiben will, muss ein Teil der „Nationalkultur“ werden. Man
könnte diesen Gedanken mit Metaphern aus der Transplantationsmedizin
illustrieren: der deutsche Volkskörper brauchte andere Organe und holte
sie ins Land, nun müssen diese Organe
zu den eigenen werden, sonst werden sie abgestoßen. Und in
diesem Diskurs wäre Interkulturarbeit die medikamentöse Verhinderung
der Abstoßungsreaktion.
Die Bundesrepublik wurde aber keinesfalls als konsequente
Weiterführung alter Ideen angelegt. Sie stellt durchaus auch einen
Bruch mit der Tradition des Autoritären dar, was beispielsweise
Heinrich Mann in seinem Roman „Der Untertan“ charakteristisch beschrieb.
Der Föderalismus, der Verfassungskern mit
den Menschenrechten und auch der Artikel 14 mit seinem 2.
Absatz, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch „zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ soll, sind gesäte Samen
für eine utopisch anmutende zukünftige gerechte Gesellschaft,
in der die „Freiheit eines jeden Einzelnen das Maß für die Freiheit aller“
bedeuten kann. Diese angelegten Möglichkeiten für
Paradigmenwechsel machen den Reiz der Verfassung aus und
sie zu einem politisch liebenswerten Gut auch oder gerade für
Visionäre. Ab den 70er Jahren des 20. Jhs bis zur deutschen
Wiedervereinigung konnte man auch den Eindruck gewinnen, dass die
bundesdeutsche Gesellschaft dem Paradigma des
Pluralismus folgend bunter, vielfältiger und „multikultureller“
werden könnte. Im Grunde aber ist der Begriff der „Multikulturalität“
ohnehin mit Vorsicht zu genießen, da logischerweise
die Kultur einer Gesellschaft als Ganzes nur eine sein kann
und nicht viele. Die Frage wäre nur, ob diese Kultur eine der
möglichen Vielfalt ist oder nach Uniformität und Konformität in
einem „Volkskörper“ verlangt.
Tatsache ist, dass die sogenannten „Gastarbeiter“ keine Gäste
waren und sich auch nicht wie Gäste verhalten haben. Trotz
vielfacher Unentschlossenheit zu bleiben oder zu gehen, haben
sie sich in der bundesdeutschen Gesellschaft eingerichtet und
ihren eigenen Wünschen entsprechende Strukturen entwickelt.
Diese als „Parallelgesellschaften“ zu diffamieren, kommt einer
kulturkämpferischen Kriegserklärung gleich, in deren Konsequenz es
eigentlich nur Verlierer geben kann. Der alternative
gangbare Weg dazu ist, die föderalen und pluralen Ansätze der
Verfassungsidee zu einer für alle verbindlichen Kultur der Vielfalt
zu entwickeln. Die erste schier triviale Maxime, der man
dabei zu folgen hat, lautet: leben und leben lassen. Nicht umsonst
war das Prinzip, jeder solle nach seiner eigenen Façon
glücklich werden, sogar dem preußischen aufgeklärten Absolutismus
nicht fremd. Die interkulturelle Aufgabe müsste nun
darin bestehen, das „leben und leben lassen“ allen in dieser
Gesellschaft gleichermaßen zu vermitteln. Man kann dabei
überhaupt nicht davon ausgehen, dass die Ethnodeutschen irgend einen
Vorsprung in Sachen Toleranz und Umgang mit
kultureller Vielfalt hätten. Richtig ist, dass die Leitkulturdebatte
und Sarazzins „Deutschland schafft sich ab“ nur die Spitze des
Eisberges sind und national-chauvinistischer Rassismus noch
immer den Hauptantrieb kultureller, sportlicher und sozialpäda
gogischer Aktivität bildet. Normalität sind Diskriminierung und
Anpassungsdruck. Die rabulistisch gezogene Grenze zwischen
Assimilation und Integration hat kaum eine praktische Bedeutung.
Ohne tatsächlich vorhandene wissenschaftliche Fundierung der
Behauptungen über den Spracherwerb werden beispielsweise
Maßnahmen beschlossen, Menschen durch sanften Durck dazu
zu bewegen, ihre Kinder so früh wie möglich in Kindertagesstätten zu
schicken, um bessere Bildungschancen zu erhalten.
Dahinter verbirgt sich eine soziale Emanzipationsauffassung
aus dem totalitären Teil Deutschlands, in dem Eltern mit Kleinkindern
die Arbeit so schnell wie möglich wieder ermöglicht
wurde, indem man ihre Kinder in betrieblichen und staatlichen
Kindertagesstätten kasernierte. Im Vordergrund stand die Effizienz
in der Industriearbeit und keinesfalls das Wohl der Individuen.
Die Diskussion um das Erziehungsgeld zeigt, dass
tatsächlich Druck auf die Menschen ausgeübt werden soll, ihre
Kinder so zu erziehen, wie es der Staat für am besten hält.
Das allerdings ist kein Gedanke freiheitlich demokratischer
Grundordnung. Hier soll essenziell in das Leben von Menschen
eingegriffen werden, wie es auch mit dem Sprachzwang im
gleichen Zug geschieht.
Die Sprache ist ein schwer zu normierender elementarer Lebensbestandteil
und Äußerung eines Lebensgefühls. Ein ordentliches und vereinheitlichendes
Maß an Sprachnormierung
hat die deutsche Sprache in der Moderne seit dem frühen 19.
Jahrhundert durchgemacht. Das Hannoversche Deutsch hat
sich als hochdeutsche Norm- und Schriftsprache etabliert und
seine Funktion in der Einigung des „deutschen Vaterlandes“
übernommen. Seine Kenntnis ist mehr oder weniger eine Partizipationsbedingung
an gesellschaftlich vermitteltem Wohlstand.
Daneben aber gibt es viele deutsche Dialekte und Soziolekte,
die die Alltagssprache der Menschen ausmachen. Hier hat sich
mittlerweile auch ein deutsch-türkisches Kauderwelsch etabliert,
dessen Hauptmerkmal eine Vermischung zweier linguistisch
nicht verwandter Sprachen mit Codeswitching nach eigenen
Regeln ist. Es ist die Sprache der in Deutschland lebenden türkischstämmigen
Menschen geworden. Wie jeder Ethnodeutsche
mit Dialekt auch, müssen Menschen, die dieses Kauderwelsch
als Alltagssprache benutzen und ein Code- und Sprachsprung
nach eigenen Regeln betreiben, sich an ein Regeldeutsch halten,
wo dies gefordert wird. Dialektale Besonderheiten können
für die gesprochene Alltagssprache gelten, nicht aber für das
reguläre Hochdeutsch, dessen Vermittlung und Beherrschung
ein Gradmesser für Bildung darstellt. Und wie jedem Dialekt
ein Hauch von Provinzialismus innewohnt, so wohnt auch dem
deutsch-türkischen Kauderwelsch ein Provinzialismus inne, der
mit höherem Bildungsstand relativiert werden kann. Aber nicht
muss! Das ist eine Entscheidung, die die Individuen selbst treffen,
weil es ihr Lebensgefühl ausdrückt. Wie jemand, der über
einen sächsischen Dialekt überhaupt nicht hinauskommt, geringere
Bildungschancen hat, so hat auch jemand, der ausschließlich das
deutsch-türkische Kauderwelsch spricht, schlechtere
Bildungschancen. Andererseits wird aber auch niemand wegen
seines Dialektes benachteiligt, wenn er sonst die beruflichen
oder schulischen Anforderungen erfüllt. Genau dasselbe muss
auch für jene Menschen gelten, deren Dialekt vermeintlich
nicht der „deutschen Volksseele“ entspringt. Vielfalt bedeutet
auch Vielfalt der unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
ohne Diskriminierung. Das gelungene Zusammenleben von Menschen in
einer Gesellschaft kann nicht an
Akademikerzahlen oder Abiturienten gemessen werden. Bildungshierarchien
müssen aufgebrochen und Bedürfnisse von
Individuen zu Bildunsgmaßstäben gemacht werden. Eine sich
im Schulsystem widerspiegelnde Gesellschaftshierarchie ist keine
Einladung zum sozialfriedlichen Miteinander.
Was hat das alles mit der „Elegie der Gastarbeiterschaft“ zu
tun? Der süße Schmerz der Sehnsucht nach Heimat, nach Harmonie,
nach einem verlorengegangenen oder noch nie dagewesenen Paradies,
nach Aufgehobensein in sozialer Sicherheit
und Anerkennung bringt viele Konnotationen mit sich, die eine
Berücksichtigung verdienen, wenn sich eine Gesellschaftsphilosophie
der Interkulturalität in Köpfen und Herzen der Individuen etablieren soll.
Isoliertes Betrachten von Phänomenen
und Bekämpfen von Problemen wird da wenig Abhilfe schaffen.
Kulturhistorisches und sozialpsychologisches Feingefühl
sind gefragt und eine Politik vonnöten, die nicht Aktionspopulismus
betreibt und Aktivität vorgaukelt, sondern tatsächlich um
nachhaltige Lösungen bemüht ist. Und zugleich muss ein verantwortungsbewusster
Journalismus sensibel und antizipativ,
empathisch und weitsichtig und weniger sensationslüstern das
Alltagsbewusstsein mitgestalten. Das allerdings könnte auch ein
ins Utopische weisender schmerzlich-sehnsüchtiger Blick nach
vorne sein – eine Elegie nicht der Gastarbeiterschaft, sondern
eine Elegie der Befremdung, wie schwer Einfaches zu realisieren ist.